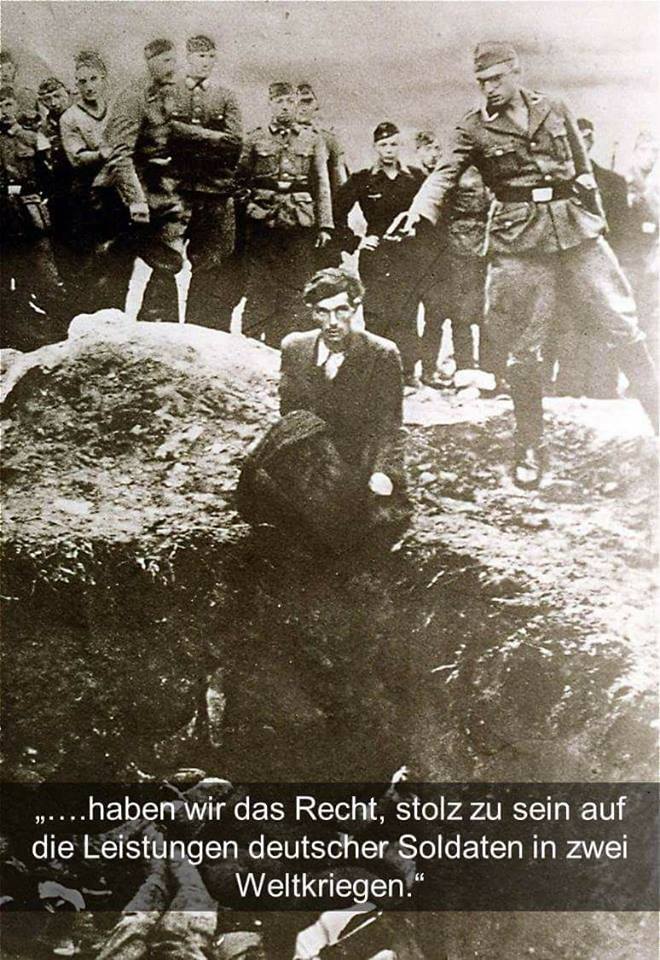Im Zusammenhang mit meiner erfolgreichen Entsperrung durch Twitter werde ich gerade andauernd gefragt, wie so eine Abmahnung funktioniert. Das Vorgehen gegen Twitter hat die Kanzlei Löffel Abrar auf ihrem Blog vor einigen Tagen ganz richtig beschrieben. Die Abmahnung ist nach deutschem Recht notwendig, damit Twitter in einem gerichtlichen Verfahren einem Antragsteller bzw. Kläger nicht entgegenhalten kann, dass es über den Grund der Beschwerde nicht informiert worden sei. Außerdem, und das ist die wohl noch wichtigere Wirkung, setzt es ein deutliches Zeichen: Sie meinen es nun sehr ernst!
Auf vielfache Nachfrage habe ich eine kleine Hilfestellung niedergeschrieben. Sie soll alle unterstützen, die mit dem richtigen Text für das Abmahnungsschreiben ringen.
Achtung: Die folgende Anleitung richtet sich ausschließlich nach dem deutschen Recht. Sie gilt nicht für Österreich, nicht für die Schweiz, nicht für Belgien, nicht für Luxemburg und schon gar nicht für Länder außerhalb des deutschen Sprachraums. Falls Sie dortiger Twitter-Nutzer sind, fragen Sie einen freundlichen Advokaten Ihres Rechtssystems nach Rat!
Grundsätzlich gilt: Das folgende Muster ist nur ein Beispiel, wie man die Sache angehen kann, und sollte auf den individuellen Einzelfall angepasst werden. Ich übernehme auch keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die Abmahnung erfolgreich ist und wie in meinem Fall zur Entsperrung des Accounts führt!
Wer es nach dieser Vorrede dennoch probieren möchte, Twitter abzumahnen, der muss sich zunächst klar machen, dass er an das Unternehmen ein Fax versenden sollte. Ja, Sie haben richtig gelesen: Im Jahre 2019 ist das Fax die sicherste Kommunikationsform gegenüber einem globalen Internetkonzern, denn ein Brief nach Irland (Twitter hat keinen offiziellen Geschäftssitz in Deutschland) bzw. in die USA hat eine relativ lange Laufzeit (was sich negativ auf das Fristerfordernis eines einstweiligen Verfügungsverfahrens auswirken könnte). Sie erhalten bei einem Brief, wie bei einer E-Mail, auch keinen Beleg, dass Ihre Abmahnung den Empfänger auch erreicht hat. Die gute alte Faxquittung ist daher Ihr Freund!
Sie adressieren Ihre Abmahnung also auf Ihrem eigenen Briefpapier an die
Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07
Ireland
Nur per Fax: +1-415-222-9958
Das Pluszeichen wird in Deutschland als zwei Nullen gewählt, die Vorwahl lautet also 001. Obwohl unser Adressat in Dublin sitzt, ist die einzige Faxnummer, die Twitter auf seinen Seiten selbst angibt, ein Anschluss im US-Bundesstaat Kalifornien (Vorwahl 415). Eigentlich ist die Faxnummer für die Meldung krimineller Aktivitäten gedacht, aber das soll uns nicht weiter bekümmern, denn nach der deutschen Rechtsprechung muss sich ein Unternehmen bzw. eine Behörde so organisieren, dass Schreiben über externe Kommunikationskanäle die richtige Stelle erreichen. Und wenn Twitter es nicht schafft, eine europäische Faxnummer anzugeben, dann ist das nicht das Problem des Verbrauchers.
Sie können übrigens das Schreiben getrost in deutscher Sprache verfassen. Das Angebot Twitters richtet sich in deutscher Sprache auf dem deutschen Markt an deutsche Verbraucher. Sie bereiten einen Rechtsstreit vor einem deutschen Gericht vor, das eine Entscheidung treffen soll, die über die europäischen Regelungen am Geschäftssitz von Twitter in Irland auch vollstreckungsfähig ist. Es ist dem Unternehmen daher problemlos zumutbar, ein deutsches Schreiben zu lesen und zu verstehen.
In die Betreffzeile schreiben Sie das Wort Abmahnung.
Danach könnte es wie folgt weitergehen:
Sehr geehrte Damen und Herren
ich bin Inhaber des Accounts @Besorgter_Twitternutzer (hier fügen Sie natürlich Ihren eigenen Twitternamen ein!) des von Ihnen unter der Adresse twitter.com betriebenen sozialen Netzwerkes. Aufgrund meines Tweets vom xx.yy.2019, xx:yy Uhr, haben Sie meinen Account am [Datum] gesperrt. Dies begründeten Sie damit, dass mein Tweet eine irreführende Information über Wahlen enthielte (oder was sonst der Sperrgrund in Ihrem Fall ist). Seither sind mir sämtliche Funktionen Ihres Netzwerks versperrt.
An dieser Stelle können Sie kurz beschreiben, warum Sie glauben, zu Unrecht gesperrt worden zu sein. Bei mir lautete die Begründung so:
Tatsächlich ist mein Tweet vom Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 GG umfasst. Dass es sich um eine ironische Bemerkung handelt, ist nicht zuletzt durch den Smiley am Ende des Tweets deutlich zu erkennen.
So kurz habe ich es tatsächlich gehalten. Sie müssen im Rahmen einer Abmahnung keine Romane schreiben – es reicht, den beanstandeten Verstoß kurz zu nennen, um dem Gegenüber die Möglichkeit der rechtlichen Überprüfung des Sachverhaltes zu geben. Sie können natürlich auch auf einen komplett missverstandenen Inhalt, übersehene Ironie, eine Äußerung im Rahmen Ihrer beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit etc. abheben – je nachdem, was auf Ihren Fall zutrifft.
Weiter geht es im Text:
Die Sperrung geschah daher rechtsmissbräuchlich. Sie verletzt weiterhin den zwischen uns bestehenden Nutzungsvertrag. Ich bin zudem bereits seit [Monat und Jahr] Nutzer Ihres Netzwerks. Ihre jüngsten Lösch- und Sperrregelungen haben Sie daher überhaupt nicht wirksam in den zwischen uns bestehenden Nutzungsvertrag einbezogen.
Seit wann Sie Twitter-Mitglied sind, können Sie auf Ihrem (wahrscheinlich auch ohne Login zugänglichen Profil) nachlesen. Wenn Sie nicht gerade in den letzten Tagen beigetreten sind, hat Twitter die Regeln zur Manipulation von Wahlen durch Falschinformationen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirksam in das zwischen Ihnen und Twitter bestehende Vertragsverhältnis einbezogen.
Falls Sie Einspruch gegen die Sperrung erhoben haben, was dringend anzuraten ist, sollten Sie noch diesen Textbaustein einfügen:
Auf meine Einsprüche vom [Tag] und vom [Tag] haben Sie bisher nicht reagiert.
Sodann folgt, am besten fettgedruckt, der Anspruch, auf den Sie sich stützen und den Sie möglicherweise im einstweiligen Verfügungsverfahren weiterverfolgen wollen:
Ich fordere Sie daher nunmehr letztmalig dazu auf, es zu unterlassen, den Tweet
„Hier steht der Tweet, um den es geht“
zu löschen und/oder mich wegen dieses Beitrags auf twitter.com zu sperren und/oder mir den Zugang zu dessen Funktionen zu verschließen.Hierfür setze ich Ihnen eine letzte Frist bis zum
xx.yy.2019, xx.yy Uhr deutscher Zeit.
Der Reaktionszeitraum für Twitter sollte knapp, aber nicht zu kurz bemessen sein, damit das Netzwerk eine reale Gelegenheit zur Überprüfung hat. Da die Frist für ein einstweiliges Verfügungsverfahren nach deutschem Recht sehr kurz ist, schlage ich hier ein bis zwei Tage vor. Ich selbst habe Twitter rund 30 Stunden Zeit gegeben, und nach etwa zwölf Stunden (ein paar Stunden nach Arbeitsbeginn in Kalifornien) war mein Account entsperrt.
Folgen sollte nun der magische Satz
Sollten Sie bis zum Ende der Frist weiterhin untätig bleiben, werde ich unverzüglich gerichtlicher Hilfe nachsuchen, um meinen Anspruch durchzusetzen.
Nun sollte auch der Letzte verstanden haben, dass Sie es ernst meinen und notfalls ein einstweiliges Verfügungsverfahren anstrengen oder eine Klage erheben werden.
Ob Sie “Mit freundlichen Grüßen” oder “Mit der Ihnen gebührenden Hochachtung” grüßen wollen, bleibt völlig Ihnen überlassen. Sie sollten die Abmahnung allerdings noch handschriftlich unterschreiben.
Sodann kann das Fax auf die Reise gehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!