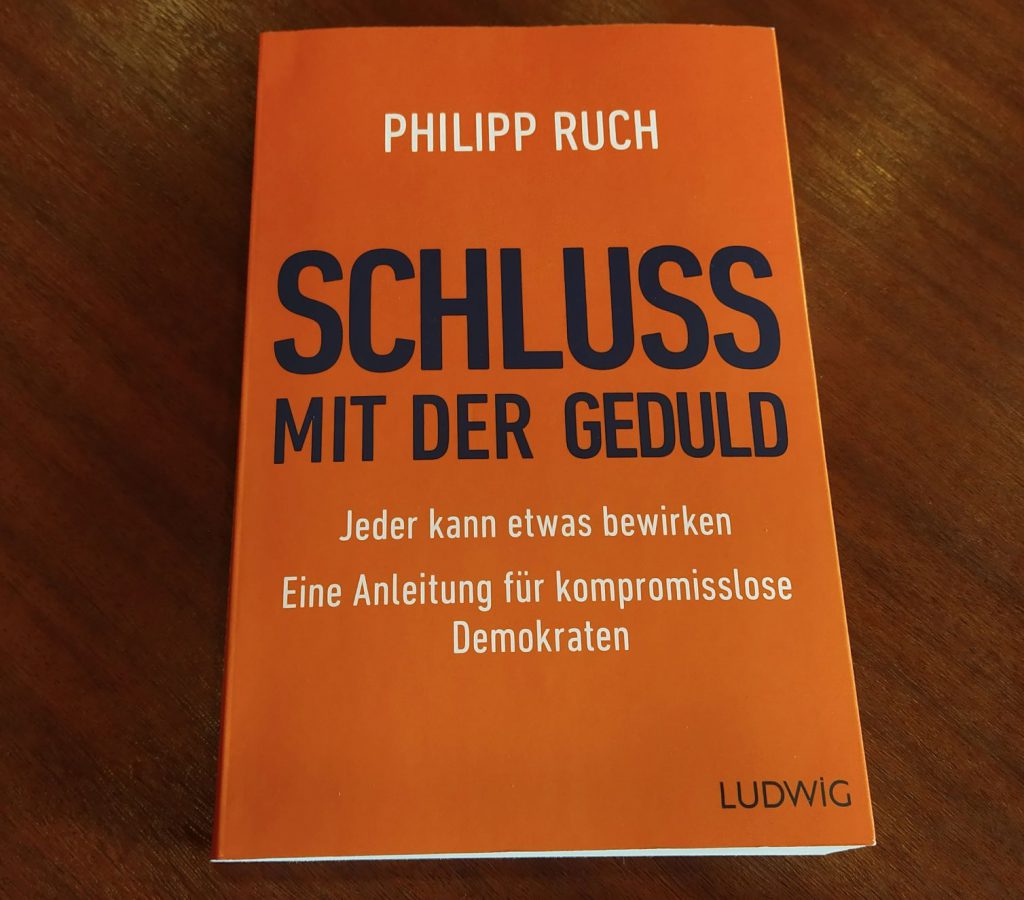Etwa eine Woche lang hat ein Shitstorm gegen meine Person angedauert, der von rechtsextremen Kreisen gesteuert und befeuert wurde. Tausende von Hasskommentaren mit Beleidigungen, Bedrohungen und sogar Mordankündigungen haben mich per E-Mail, über die sozialen Netzwerke und sogar über meinen Arbeitgeber erreicht. Auslöser des Hasses ist ein Tweet an einen Juristenkollegen, der sich mit der Legitimität gewalttätigen Handelns nichtstaatlicher Akteure beschäftigt. Im ersten Teil dieser Serie von Blogartikeln habe ich mich mit der grundsätzlichen Frage beschäftigt, ob und wann die Ausübung von Gewalt im demokratischen Rechtsstaat rechtmäßig ist. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Sondertatbestand des Art. 20 Abs. 4 GG, auf den sich mein Tweet bezieht. Im heutigen ersten Teil dieses Beitrags geht es zunächst um die Entstehungsgeschichte der Norm. Der zweite Teil wird sich mit dem Inhalt und den Grenzen des Widerstandsrechts auseinandersetzen.
Im Jahre 1945 lag Deutschland nicht nur materiell, sondern auch moralisch in Trümmern. Das zwölf Jahre andauernde, “tausendjährige Reich” hatte nicht nur einen verbrecherischen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen und weite Teile Europas verheert, sondern auch Millionen von Zivilisten aus niedrigsten Beweggründen ermordet – in den Konzentrationslagern Auschwitz, Majdanek, Belzec, Treblinka und Sobibor sogar auf industrielle Art und Weise. Der deutsche Staat, eine einstmals stolze Kulturnation, war verantwortlich für einen ebenso traurigen wie singulären Höhepunkt in der Verbrechensgeschichte der Menschheit.
Als Reaktion darauf verlor Deutschland nicht nur einen Teil seines Territoriums, dessen bisherige Bewohner größtenteils vertrieben wurden. Es wurde auch den Besatzungsmächten unterstellt, die für eine gewisse Zeit die deutsche Staatsgewalt ausübten. Dass dies, gerade vor dem Hintergrund des soeben beginnenden Ost-West-Konfliktes, kein Dauerzustand bleiben konnte, wurde den Regierungen in Washington, London und Paris sehr schnell klar. Auf der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz im Frühjahr 1948, an der neben den drei westlichen Besatzungsmächten auch die Regierungen der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs teilnahmen, wurde der zukünftige Status des westlichen deutschen Landesteils intensiv diskutiert. Die Mächte einigten sich auf einen föderativen Staatsaufbau unter internationaler Kontrolle der Montanindustrie. Damit waren nicht nur die Weichen für die Gründung der Bundesrepublik, sondern auch der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gelegt, die sich mittlerweile zur Europäischen Union weiterentwickelt hat.
Der weitere Verlauf der Geschichte ist bekannt: Auf dem Konvent von Herrenchiemsee und im Parlamentarischen Rat in Bonn wurde das Grundgesetz erarbeitet, das zunächst die westdeutschen Bundesländer annahmen (lediglich Bayern stimmte nur unter dem Vorbehalt zu, dass mindestens zwei Drittel der übrigen Länder das Grundgesetz ratifzierten). Am 23. Mai 1949 stimmte auch der Parlamentarische Rat mit Ausnahme zweier kommunistischer Abgeordnete für die neue deutsche Verfassung.
Als das Grundgesetz am 24. Mai 1949 in Kraft trat, stellte es einen bewussten Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Terrorherrschaft dar, indem es die Menschenwürde als zentralen Verfassungswert benannte und den Katalog der Grundrechte für die deutschen Bürgerinnen und Bürger sowie der Menschenrechte den Normen über den Staatsaufbau voranstellte. In Art. 20 GG fanden sich die Staatsprinzipien der Bundesrepublik: Demokratie, Sozialstaat, Bundesstaat und Rechtsstaat. Das Widerstandsrecht, das heute in Art. 20 Abs. 4 GG normiert ist, fand sich zu jener Zeit aber noch nicht in der Verfassung.
Dabei hatte der Parlamentarische Rat ausführlich über die Einführung eines Widerstandsrechts gegen verbrecherisches Regierungshandeln beraten. Besonders der nationalkonservative Abgeordnete Hans-Christoph Seebohm von der Deutschen Partei (DP, später wechselte er zur CDU und wurde langjähriger Bundesverkehrsminister) forderte vehement, eine Widerstandsregelung in das Grundgesetz aufzunehmen:
“Bei Verfassungsbruch sowie rechts- und sittenwidrigem Mißbrauch der Staatsgewalt wird ein Widerstandsrecht anerkannt. Öffentliche Amtsträger sind in diesen Fällen zum Widerstand verpflichtet.”
Dieses Ansinnen scheiterte ausgerechnet an der SPD, deren einflussreicher Abgeordneter Carlo Schmid darin eine “Aufforderung zum Landfriedensbruch” zu entdecken vermochte. In einigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und der Fachgerichte aus den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik betonte die Judikative allerdings, dass ein solches Widerstandsrecht der Rechtsordnung inzwischen nicht mehr fremd sei.
Damit hätte es sein Bewenden haben können. Doch im Jahre 1968 verabschiedete der Deutsche Bundestag vor dem Eindruck des sich verschärfenden Ost-West-Konflikts sowie zunehmender Proteste von Studierenden und anderer Teile der Bevölkerung die Pläne für eine Notstandsverfassung. Neben der militärischen und politischen Begründung für die neuen Grundgesetz-Regelungen über den Ausnahmezustand, den Spannungsfall, den Verteidigungsfall und den Katastrophenfall trat der Wunsch der Bundesregierung, weitere Souveränität gegenüber den alliierten Mächten zu erhalten, deren Notstandsrechte erst mit dem Beschluss der Notstandsverfassung erloschen.
In der Politik und in der allgemeinen Öffentlichkeit fand diese Grundgesetzänderung ein geteiltes Echo. Während viele in ihr eine Stärkung der westdeutschen Demokratie sahen, die mit den neuen Regelungen auch für politisch und militärisch schwierige Zeiten gewappnet war, befürchteten andere Zustände wie am Ende der Weimarer Republik, in der immer kürzer amtierende Regierungen nur noch mittels Notverordnungen regieren konnten – was am Ende geradewegs in die nationalsozialistische Diktatur führte.
Zur Beruhigung der Kritik entschied sich die parlamentarische Mehrheit daher im Juni 1968 und damit rund einen Monat nach Verabschiedung der Notstandsgesetze dazu, auch das Widerstandsrecht in das Grundgesetz aufzunehmen. Damit sollte einerseits Misstrauen in der Bevölkerung gegen einen zu autoritär auftretenden Staat abgebaut und andererseits klar gestellt werden, dass der Schutz des demokratischen Rechtsstaats nicht allein der öffentlichen Gewalt obliegt, sondern zugleich Aufgabe jeder Staatsbürgerin und jedes Staatsbürgers ist. Denn der neue Art. 20 Abs. 4 GG ist zwar als ultima ratio für die akute, schwerste Bedrohung bzw. den Fall des demokratischen Rechtsstaats ausgestaltet, kann aber zugleich als “Jedermannsrecht” von jeder und jedem Einzelnen unabhängig von Stellung, Beruf oder Amtsträgereigenschaft in Anspruch genommen werden.
Zugleich beendete die Verabschiedung des Art. 20 Abs. 4 GG auch eine jahrzehntelange Debatte über die Frage, ob die Widerstandstaten gegen das verbrecherische Regime der Nationalsozialisten gerechtfertigt gewesen seien. Denn das Hitler-Regime hatte sich seit der Machtergreifung im Jahre 1933 stets mit dem Schein der Legalität ummantelt und versucht, auch nur die Vermutung eines revolutionären Umbruchs zu widerlegen. Die Gesetze des Kaiserreichs und der Weimarer Republik galten formal weiter, und der nationalsozialistische Gesetzgeber begnügte sich mit “Korrekturen”: Erst strich er Juden und andere Gegner aus dem Kreise der “Volks-” , dann aus dem der “Rechtsgenossen”, und nach dem sozialen Tod folgte die physische Vernichtung. Der Reichstag wurde erst angezündet, dann komplett ausgeschaltet. Nationalsozialistische “Rechtswahrer” wie der zwar intellektuell brillante, aber moralisch völlig verkommene Rechtsprofessor Carl Schmitt legitimierten nicht nur jedes materielle Unrecht. Sie erklärten auch die Einhaltung formeller Rechtsvorschriften für obsolet, indem sie den Führerbefehl oder auch nur einen (im schlimmsten Fall fiktiven) Führerwillen als gleichwertig mit dem Gesetz oder ihm sogar übergeordnet sahen.
Dennoch waren viele Deutsche in der jungen Bundesrepublik der Ansicht, dass der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, wie sie beispielsweise viele Kommunisten und Sozialdemokraten, die Mitglieder der Weißen Rose oder des Kreisauer Kreises geleistet hatten, unrechtmäßig gewesen sei. Noch bis in die 1970er Jahre galten Angehörige des Widerstandes als Vaterlandsverräter, zumal während des Krieges – heute sieht sie die große Mehrheit der Bevölkerung als Helden an. Der Rechtslehrer Gustav Radbruch, der als erster deutscher Professor am 8. Mai 1933 aus dem Staatsdienst entlassen worden war, verfasste kurz nach dem Krieg noch unter dem Eindruck der NS-Staatstätigkeit seine Lehre vom gesetzlichen Unrecht, das dem überpositiven, gerechten Recht weichen müsse. Mit der Kodifizierung des Widerstandsrechts in Art. 20 Abs. 4 GG hat sich diese Lehre endgültig durchgesetzt. Im Juni 1968 hat der Deutsche Bundestag letztlich auch ein Zeichen dafür gesetzt, dass der Widerstand gegen das verbrecherische Hitler-Regime gerecht und gut war.
Neben dieser historischen Komponente ist das Widerstandsrecht des Art. 20 Abs. 4 GG auch eine geltende Verfassungsnorm, die nur derzeit (glücklicherweise) keinen Anwendungsbereich besitzt und hoffentlich niemals einen besitzen wird. Wie der Tatbestand des Widerstandsrecht heute ausgestaltet ist, wann er eingreift, was er erlaubt und wo seine tatsächlichen und rechtlichen Grenzen liegen, davon soll im folgenden Blogbeitrag dieser Serie die Rede sein.