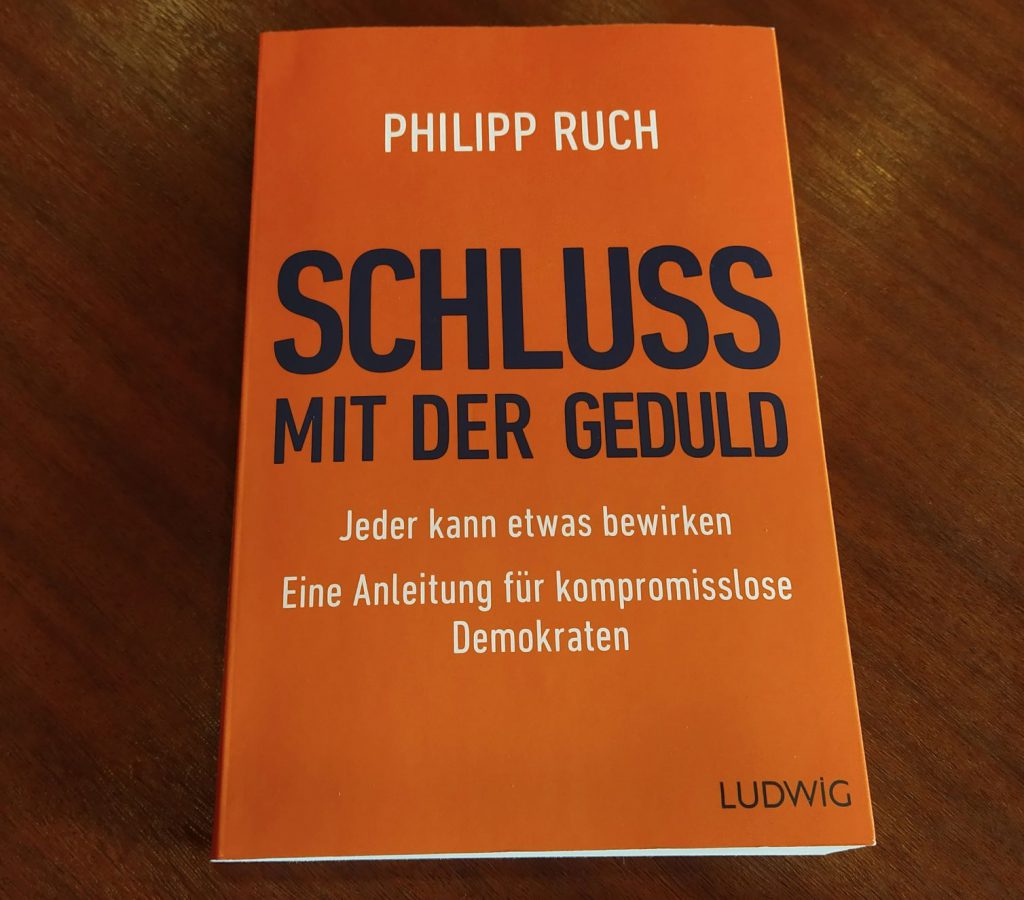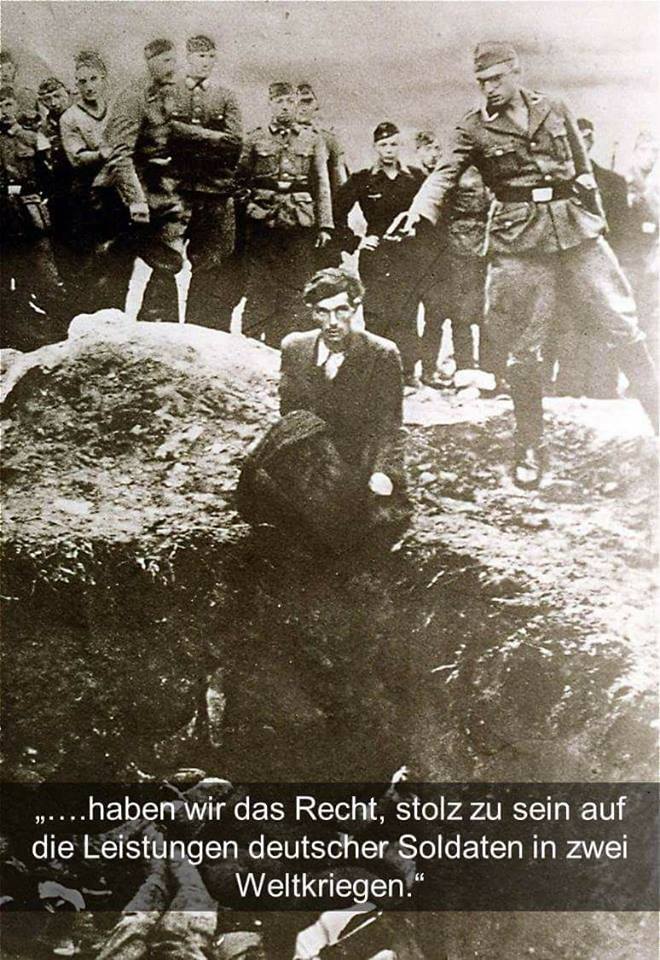Der folgende Text ist ein Gastbeitrag einer Lehrerin aus Süddeutschland, die anonym bleiben möchte. Sie ist an Corona erkrankt und schildert ihre Erfahrungen mit der Gesundheitsbürokratie.
Ich bin krank. Nach zwei positiven Selbsttests kann ich wohl davon ausgehen, dass ich mir irgendwo Covid geschnappt habe. Auch wenn sich das für manche scheinheilig anhört: Ich weiß nicht, wo ich mir das gefangen haben könnte. In der Schule testen wir regelmäßig und da war niemand positiv.
Privat habe ich niemanden getroffen – abgesehen von meinen arg pflegebedürftigen Eltern. Ich war nur Lebensmittel einkaufen mit FFP2, wie es sich gehört. Ich versuche beim Einkauf auch immer die publikumsintensiven Zeiten zu meiden, was mir einen gewissen Abstand zu anderen Menschen erst ermöglicht.
Mir geht es den Umständen entsprechend recht gut. Ich bin zwar schlapp und kränklich, bislang habe ich aber nicht das Gefühl, als könnte das noch lebensbedrohliche Züge annehmen. Womöglich liegt das auch an der ersten Impfdosis, die ich bereits intus habe. Außerdem habe ich kein Problem mit der Isolation, da ich sowieso allein lebe.
Es begann am Mittwoch. Morgens wurde ich zusammen mit den Kindern noch negativ getestet. Mittags bin ich zu meinen Eltern gefahren. Im Laufe des Nachmittags entwickelte ich leichte Erkältungssymptome. Ich dachte mir wenig dabei, hatte ich doch vom Morgen noch den negativen Test. Trotzdem habe ich mich vorsichtshalber mal isoliert (ich bin also schlicht nachhause gefahren). Abgesehen von der einen Stunde am Mittwoch habe ich keinen Präsenzunterricht, da fällt die Selbstisolation leicht.
Am Freitag habe ich erneut einen Selbsttest gemacht, am Samstag nochmal wiederholt und der T-Strich nahm an Deutlichkeit zu. Bislang fehlt der Geschichte noch die echte Dramatik… kommt jetzt:
Meine Eltern sind beide Ü80 und daher in Prio 1. Das hat meinen Vater aber nicht davon abgehalten, zu bocken und die Impfung abzulehnen. Mein Sohn – der zwischenzeitlich gerichtlich bestellter Betreuer meines Vater ist – hat angefragt, ob mein Vater nicht im Klinikum geimpft werden könne. Nebenbei wäre es tatsächlich sehr schwierig gewesen, meinen immobilen Vater ins Impfzentrum zu wuchten. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen können stationär aufgenommene Patienten nicht geimpft werden. Personal ja – Hausärzte dürfen auch impfen… mein Vater war also ungeimpft. Es kam also, wie es kommen musste: Ich habe ihn angesteckt. Gestern hatte er einen positiven Selbsttest. Offenbar war er noch symptomfrei, aber meine Hauptsorge gilt momentan bestimmt nicht meiner eigenen Gesundheit.
Was ich damit zum Ausdruck bringen will: Es ist ein Märchen, dass man sich genügend selbst schützen kann, solange man die gängigen AHA-Regeln einhält. Das Virus passt sich durch seine Mutanten den Umständen wesentlich schneller und effektiver an, als wir mit Desinfektionslösung kontern können. Warum kann man keine stationären Patienten impfen? Und um endlich auf den Punkt zu kommen: Da ich am Freitag erst gegen 18 Uhr positiv getestet wurde, war auch das Faxgerät des Gesundheitsamts schon im Wochenende.
Das Wort kafkaesk konnte ich noch nie leiden. Wenn es jemand verwendet, dann denke ich heimlich: „Ja, du Wichtigtuer, wir wissen jetzt, dass du Abitur hast. Komm endlich auf den Punkt!“ Was ich heute erlebt habe, kann ich aber wirklich nur mit kafkaesk umschreiben. Nach vielen Telefonaten habe ich extrem widersprüchliche Informationen und Anweisungen erhalten. Der genaue Ablauf spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ich erzähle einfach in Stichpunkten.
- Das Gesundheitsamt fordert einen PCR-Test zur Bestätigung der vorläufigen Selbstdiagnose.
- Der Hausarzt testet nicht.
- Am Stadion ist die einzige PCR-Teststation der Stadt, die testen aber keine Menschen mit Symptomen.
- Das Gesundheitsamt meint, der ärztliche Notdienst sei zuständig.
- Der ärztliche Notdienst meint, das Gesundheitsamt sei zuständig… oder vielleicht auch die Kassenärztliche Vereinigung.
- Die Kassenärztliche Vereinigung meint, ich sei selbst zuständig
- Ich: WTF?
- Gesundheitsamt: Fahren Sie doch mit einem Spezialtaxi zu irgendeiner Praxis.
- Taxiunternehmen: Ja, das kostet aber extra. Lassen Sie sich einen Krankentransportschein vom Hausarzt ausstellen.
Es ist 12:09 Uhr. In der Hausarztpraxis erreiche ich keinen mehr.
- Neue Information vom Gesundheitsamt über meine Chefin: Mit dem Taxi fährst du überhaupt nirgendwo hin. Da muss jemand zum Testen zu dir kommen. Die erste gute Nachricht heute.
- Eigentlich ist mir der PCR-Test völlig wumpe. Ich weiß ja, dass ich krank bin. Darf ich bitte wieder ins Bett?
- Schicksal: nö!
- Chefin: Wir brauchen den PCR-Test, weil wir sonst die Kinder, mit denen du letzte Woche Montag und Mittwoch Kontakt hattest, nicht in Quarantäne schicken können.
Aha … und dann? Wie viele Kontakte hatten die wohl in der ganzen Woche? Wozu testen wir die alle zwei Tage?
Ich habe momentan kein Auto, kann also auch zu keiner Praxis fahren. Und selbst wenn ich ein Auto hätte, bezweifle ich, dass ich voll verkehrstüchtig bin.
- Ärztlicher Notdienst: Sie könnten mit dem Fahrrad zur M. Straße fahren. Dort gibt es eine Praxis, die testet.
- Ich (nur in meinem Kopf): Gute Idee! Da kann ich gleich noch beim McDonald’s ein McRib-Menü mit Fritten und Cola holen.
- Ich (die Contenance ließ auch das in meinem Kopf): Sind Sie komplett bescheuert? Ich soll hochinfektiös durch die Gegend radeln und mich dann von dem Arzt anraunzen lassen, wie ich auf so eine dämliche Idee komme?
- Ich (soweit reichte die Contenance dann doch nicht mehr): Da habe ich ja mal Glück gehabt, dass ich nicht operiert werden muss. Sonst müsste ich am Ende die Wundhaken noch selbst halten.
Interessant, wie man anderer Leute blöden Blick durch das Telefon zu sehen glaubt.
- Chefin: Neuer Twist vom Gesundheitsamt. Du bekommst eine Ausnahmegenehmigung und darfst dich am Stadion testen lassen. Der Sohn bekommt auch eine Ausnahmegenehmigung, dass er dich fahren darf. Geh bitte gleich zur Online-Terminvereinbarung!
- Online-Terminvereinbarung: Heute sind keine Termine mehr verfügbar.
- Gesundheitsamt: Aber wir brauchen den Test noch heute. Nein, wir haben keinen Einfluss auf die Terminvergabe.
Inzwischen ist es 15:30 Uhr. Ich habe den ganzen Tag noch nichts weiter gemacht, als mich um diesen blöden PCR-Test zu bemühen, der zwar gesetzlich vorgeschrieben ist, es aber offenbar dennoch Neuland für alle Beteiligten ist.
Immerhin habe ich ganz tolle Genehmigungen. Wie war das nochmal mit diesem praktischen Arzt? In keiner der Praxen der Gemeinschaft B. geht auch nur irgendwer ans Telefon. Ich habe mich heute acht Stunden lang um den blöden PCR-Test bemüht. Für morgen 8:15 Uhr habe ich einen Termin am Stadion. Das diabolische Männchen in meinem Inneren ruft: „Du hättest ja keinem sagen müssen, dass du Symptome hast. Dann hätte es heute früh nur fünf Minuten gedauert, den Termin zu bekommen.“
Gegessen habe ich heute auch noch nichts. Gut, dass ich im Grunde meines Herzens ein friedfertiger und kooperativer Mensch bin. Aber heute stimme ich Goethe zu: Ich kann mir kein Verbrechen vorstellen, das nicht auch ich hätte begehen können! Sollte das alles nur ein Trick sein, um die Infektionszahlen gering(er) zu halten?
- Chefin: Schöne Grüße von der Frau Gesundheitsamt. Warum hast du nicht gleich am Freitag angerufen? Ich habe ihr gesagt, das hättest du gemacht und nur noch das Ansageband erreicht. Ihr Kommentar: Ach ja, das stimmt natürlich.
Vierundzwanzig Stunden nach dem Test kam eine Rückmeldung seitens des Gesundheitsamts. Freundlicherweise haben sie direkt meine Chefin informiert – nicht etwa mich.
Hätte nicht jeder vernünftige Mensch an einem Punkt gesagt: Ich habe eine meldepflichtige Krankheit gemeldet und bin daher raus aus der Nummer. Liegt die Pandemiebekämpfung tatsächlich auf den Schultern der Patienten?